STEUERN
Zollrechtliche Risiken der grenzüberschreitenden Fahrzeugnutzung
Die internationale Mobilität von Mitarbeitenden nimmt stetig zu – und mit ihr die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen. Gerade der Grenzübertritt mit Fahrzeugen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union birgt zahlreiche zollrechtliche Fallstricke, die in der Praxis oft unterschätzt werden.
Ob Firmenwagen für Grenzgänger, Servicefahrzeuge für internationale Einsätze oder Kundenbesuche mit dem Privatauto: Täglich werden Fahrzeuge über die Grenzen zwischen der Schweiz und der EU1 bewegt. Was im Alltag selbstverständlich erscheint, ist zollrechtlich alles andere als trivial. Denn Firmen- und Privatfahrzeuge gelten als Waren und unterliegen beim Grenzübertritt den gesetzlichen Regelungen, auch bei temporärer Nutzung. Die Folge: Unternehmen und Privatpersonen sind automatisch den Vorschriften mehrerer Staaten unterstellt, die selten deckungsgleich sind. Wer die Regeln nicht kennt oder missachtet, riskiert empfindliche Nachzahlungen, Bussgelder bis hin zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs.
Grundsätze des Zollrechts
Sowohl im Zollrecht der Schweiz2 als auch der EU3 müssen Fahrzeuge, die in ein Zollgebiet eingeführt werden, grundsätzlich verzollt und die anfallenden Abgaben entrichtet werden. Erst wenn ein Fahrzeug im sog. «zollrechtlich freien Verkehr» steht, kann es uneingeschränkt genutzt werden. Um die Mobilität zu erleichtern, dürfen ausländische Fahrzeuge in der Schweiz und der EU im Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung ohne förmliche Zollanmeldung und ohne Entrichtung von Abgaben genutzt werden. Beide Rechtsräume stützen sich auf das Istanbul-Übereinkommen4, welches die zulässigen Verwendungszwecke sowie die Erleichterungen bei der Einfuhr von Beförderungsmitteln5 festlegt. Diese greifen jedoch nur, sofern
- das Fahrzeug im Ausland immatrikuliert ist,
- die Verwendung im Interesse einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz ausserhalb des Zollgebiets erfolgt,
- die Nutzung zeitlich begrenzt ist und
- das Fahrzeug wieder unverändert ausgeführt wird.
Schweizer und EU-Zollrecht konkretisieren diese Grundsätze in ihren jeweiligen Rechtserlassen,6 um eine Balance zwischen reibungsloser, internationaler Mobilität und Fairness zu erreichen. Die Missachtung der Vorschriften führt zur Pflicht, das Fahrzeug in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen.7
So ist in der Schweiz die Verwendung ausländischer Beförderungsmittel für gewerbliche Inlandtransporte und geschäftliche Fahrten im Auftrag eines Schweizer Arbeitgebers nicht zulässig. Zudem ist Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz die Nutzung ausländischer Fahrzeuge grundsätzlich untersagt, ausser für den direkten Arbeitsweg bei Anstellung im Ausland oder mit spezieller Bewilligung (z.B. für Wochenaufenthalter).8
Umgekehrt dürfen in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge von EU-Grenzgängern nur für den direkten Arbeitsweg und geschäftliche Fahrten im Auftrag des Schweizer Arbeitgebers genutzt werden. Weitergehende Privatnutzung (z.B. Wochenende, Ferien) in der EU ist nicht erlaubt.9
Herausforderungen in der Praxis
Im Alltag erfolgt der Grenzübertritt mit einem Fahrzeug so reibungslos, dass die zollrechtlichen Auswirkungen kaum wahrgenommen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die typischen Fallkonstellationen aus Zollsicht oft mehrere Sachverhalte und entsprechende Risiken umfassen:
- Ein in Deutschland wohnhafter Mitarbeiter, der einen Schweizer Firmenwagen erhält, darf damit den Arbeitsweg und geschäftliche Fahrten absolvieren. Nutzt er das Fahrzeug jedoch privat in der EU, etwa für einen Wochenendausflug, entsteht eine Einfuhrpflicht in der EU.
- Fährt eine Grenzgängerin mit ihrem in Deutschland zugelassenen Privatwagen zur Arbeit in die Schweiz, ist dies für den Arbeitsweg zulässig. Führt sie jedoch im Auftrag des Schweizer Arbeitgebers geschäftliche Fahrten innerhalb der Schweiz durch – z.B. Kundenbesuche –, droht die Pflicht zur Verzollung in der Schweiz.
Somit muss die zollrechtliche Einordnung für jede Fahrt getrennt betrachtet werden. Der primäre Unterscheidungsfaktor ist dabei die Art der Nutzung – geschäftlich, privat oder für den direkten Arbeitsweg. Es empfiehlt sich, dass Mitarbeitende stets eine Kopie des Arbeitsvertrags und eine Bestätigung des Arbeitgebers dabeihaben. Die Fahrten sollten durch ein Bordbuch oder GPS-Auswertungen dokumentiert werden, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.
Für die uneingeschränkte Nutzung von Fahrzeugen sowohl in der EU als auch in der Schweiz wird in der Praxis oft die «Doppelverzollung» genutzt, wobei das Fahrzeug schliesslich im zollrechtlich freien Verkehr beider Zollgebiete steht.
Ein weiterer Stolperstein sind die im Fahrzeug mitgeführten Waren. Berufsausrüstung kann meist formlos ein- und ausgeführt werden, bei teurer oder umfangreicher Ausstattung ist jedoch häufig eine schriftliche Anmeldung erforderlich (z.B. mittels Carnet ATA). Ersatzteile und Waren für Kundenaufträge müssen regulär verzollt werden.
Weitere steuerliche und rechtliche Aspekte
Die Überlassung eines Firmenfahrzeugs an Mitarbeitende mit Wohnsitz im Ausland kann in der EU als langfristige Vermietung gelten und eine MWST-/Umsatzsteuerpflicht im Wohnsitzstaat der Mitarbeitenden auslösen. Schweizer Arbeitgeber müssen sich unter Umständen in Deutschland oder Österreich registrieren und die Privatnutzung (inkl. Arbeitsweg) versteuern. In der Schweiz ist der Privatanteil ebenfalls zu deklarieren, sofern die Nutzung nicht überwiegend im Ausland erfolgt.10
Weiter stellt die private Nutzung eines Firmenfahrzeugs einen geldwerten Vorteil dar und kann lohnsteuer- sowie sozialversicherungspflichtig sein. Die Bewertung und Deklaration erfolgt nach nationalem Recht und kann zu Doppelbesteuerung führen, wenn die Regelungen nicht sauber abgestimmt sind.
Daneben gilt es, auch andere Rechtsgebiete zu beachten wie das Strassenverkehrsrecht (bzgl. Zulassungsvorschriften) und das Arbeitsvertragsrecht.
Risiken erkennen, Einzelfälle prüfen, Compliance sichern
Die grenzüberschreitende Nutzung von Fahrzeugen ist ein vielschichtiges Thema mit erheblichen Risiken für Unternehmen und Mitarbeitende. Verstösse gegen die strikten und teilweise nicht harmonisierten Vorschriften können teuer werden. Pauschale Lösungen gibt es nicht – wer jedoch Sitz oder Wohnsitz, Zulassungsland und Nutzungsart sowie die weiteren rechtlichen Auswirkungen konsequent prüft, kann das Risiko deutlich reduzieren.
Unternehmen sollten klare Regelungen zur Nutzung von Firmenfahrzeugen treffen und im Zweifelsfall Experten involvieren. Nur so lassen sich böse Überraschungen und finanzielle Risiken vermeiden.
1 Als EU werden hier zusammenfassend die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bezeichnet.
2 Zollgesetz (ZG; SR 631.01) sowie die darauf gestützten Verordnungen.
3 Unionszollkodex (UZK; Verordnung (EU) Nr. 952/2013); UZK-Durchführungsrechtsakt (UZK-IA; Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447); Delegierte Verordnung zum UZK (UZK-DA; Verordnung (EU) 2015/2446).
4 Anlage C «Beförderungsmittel» des Übereinkommens über die vorübergehende Verwendung (Istanbul-Übereinkommen; SR 0.631.24).
5 Dem Begriff Beförderungsmittel sind in diesem Artikel Bezeichnungen wie Personenwagen, Kraftfahrzeug, Dienstwagen, Firmenwagen, Privatfahrzeug etc. gleichgesetzt, wo nicht explizit anderweitig erwähnt.
6 Art. 34 und 35 Zollverordnung (ZV; SR 631.01); Art. 215 UZK-DA.
7 Art. 58 Abs. 3 ZG und Art. 79 UZK.
8 Art. 34, 35 und 36 ZV.
9 Art. 215 Abs. 3 UZK-DA; Durchführungsbestimmungen zum Unionszollkodex.
10 § 3a Abs. 3 UStG (Deutschland); § 3a UStG (Österreich); MWSTG (Schweiz).





















































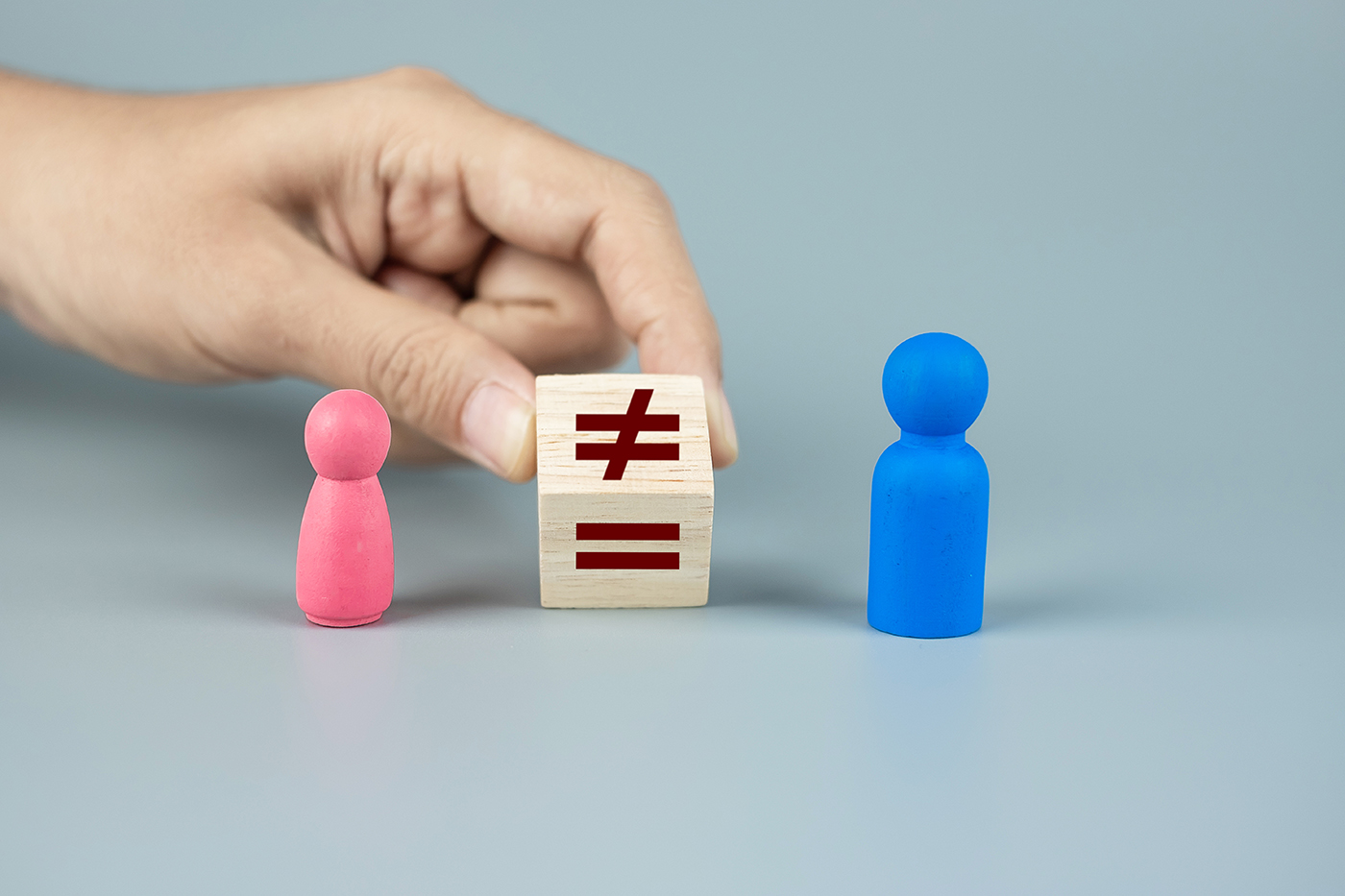

































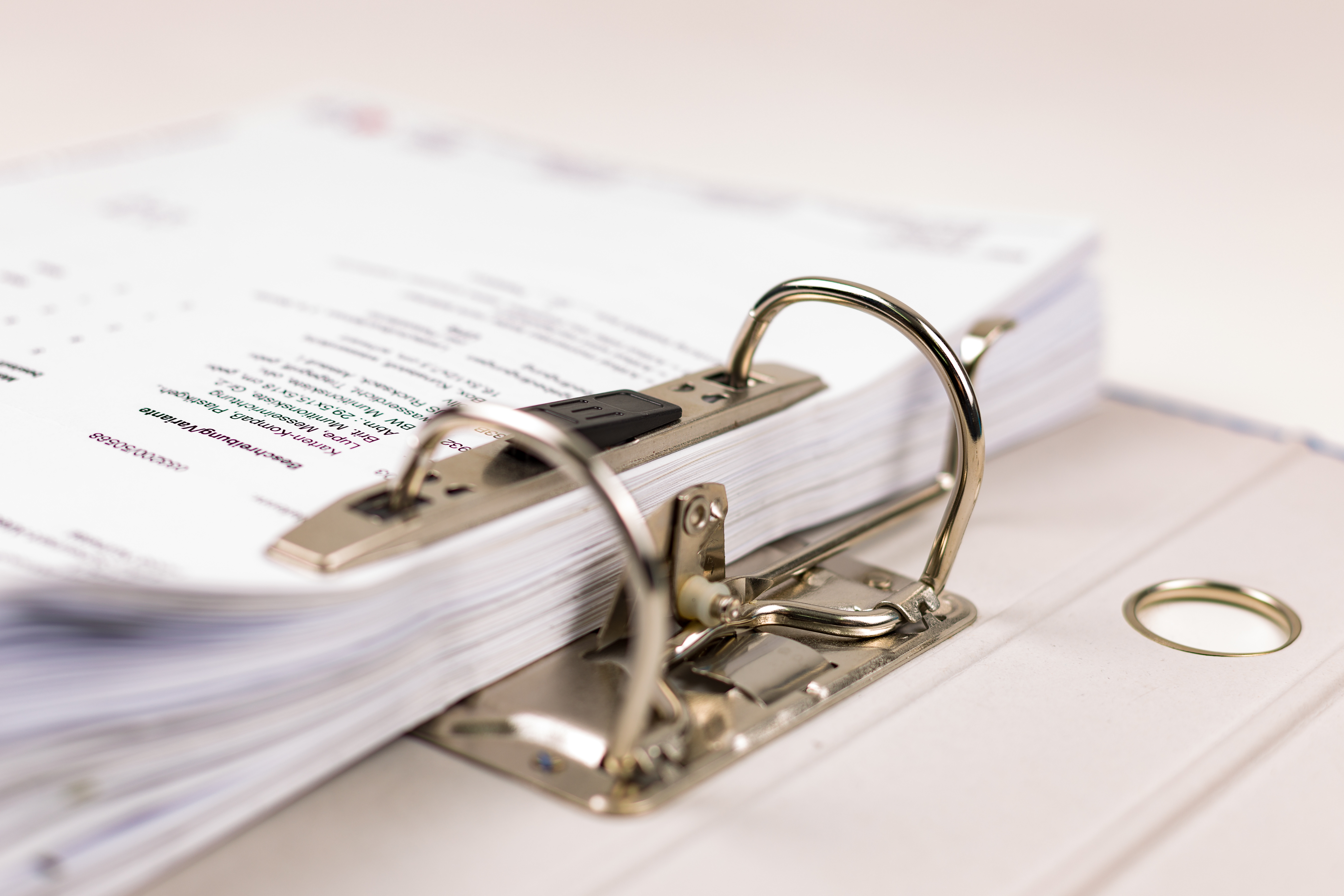



Kommentieren