IFRS
Reverse Factoring:
Erste Erfahrungen mit den neuen IFRS-Offenlegungspflichten
Die neuen IFRS-Offenlegungspflichten beabsichtigen seit dem 1. Januar 2024 mehr Transparenz von Reverse-Factoring-Arrangements. Doch wie gelingt die Umsetzung in der Praxis? Es zeigen sich zentrale Herausforderungen, aber auch erste Lösungsansätze.
Mit Inkrafttreten der Änderungen zu IAS 7 und IFRS 7 sind Unternehmen seit dem 1. Januar 2024 verpflichtet, umfangreichere qualitative und quantitative Informationen zu Supplier Finance Arrangements (SFAs) in den Anhangangaben der Jahresrechnungen offenzulegen. Ziel des IASB ist es, die Transparenz über Umfang, Struktur und Liquiditätsrisiken solcher Programme zu erhöhen, und somit die Informationsasymmetrie zwischen Unternehmen und Bilanzadressaten zu verringern. Diese Informationen müssen offengelegt werden, unabhängig davon, ob eine Ausbuchung der ursprünglichen Verbindlichkeit und Erfassung einer neuen Schuld gemäss IFRS 9 erforderlich ist. Erste Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass der neue Transparenzfokus neben technischen Herausforderungen auch zu vertieften internen Auseinandersetzungen von Verantwortlichkeiten, Prozessen und Datengrundlagen der Reverse-Factoring-Programme führt.
Was ist Reverse Factoring?
Reverse Factoring (Supplier-Finance-Arrangements) ist eine von einem Unternehmen initiierte Finanzierung, bei der das Unternehmen seine Lieferantenrechnungen durch einen Factor, in der Regel eine Bank oder ein Finanzdienstleister, (frühzeitig) begleichen lässt. Das Unternehmen selbst bezahlt den Factor hingegen erst am oder nach dem Fälligkeitstag der Rechnung, wobei die genauen Zahlungsmodalitäten individuell vereinbart werden. Der Factor wiederum erhält für die Zwischenfinanzierung in der Regel Zinsen auf den vorfinanzierten Betrag und/oder eine Servicegebühr. Seit 2024 müssen Unternehmen im Zusammenhang mit Reverse-Factoring-Vereinbarungen detaillierte Angaben bezüglich Vertragskonditionen, Buchwerten, Fälligkeiten der Verbindlichkeiten und Liquiditätsrisiken offenlegen, um Umfang, Struktur und potenzielle Auswirkungen der Reverse-Factoring- Programme auf Verbindlichkeiten und Geldflüsse zu verdeutlichen und so Informationslücken zwischen Unternehmen und Bilanzadressaten zu verringern.
Herausforderungen bei der erstmaligen Umsetzung
Die erstmalige Umsetzung der neuen Offenlegungspflichten bezüglich SFAs zeigt, dass Unternehmen mit strukturellen und systemischen Herausforderungen konfrontiert sind. Insbesondere multinationale Konzerne stehen vor der Aufgabe, aus fragmentierten ERP-Systemen, dezentralen Buchungslogiken und fehlenden standardisierten Datenfeldern relevante Informationen auf Rechnungsebene, wie Zahlungsziele, Programmdauer oder Statusinformationen zur Finanzierung durch externe Factors konsistent zu erheben. Hinzu kommt, dass die Einbindung externer Factor-Daten zusätzliche Komplexität schafft, da unterschiedliche technische Schnittstellen zu Verzögerungen und Inkonsistenzen in der Datenverarbeitung führen. Diese heterogene und potenziell unvollständige Datenlage erschwert eine einheitliche und vollständige Offenlegung der geforderten Informationen. Dies ist besonders herausfordernd für Tochterunternehmen, welche Teil grösserer Strukturen sind und relevante Daten für den Konzernabschluss zuliefern müssen. Zusätzliche Kontrollen, Schulungen und einheitliche Datenstrukturen müssen eingeführt werden, was einen deutlichen Mehraufwand bedeutet.
Eine weitere Herausforderung betrifft die Identifikation der Programme, die in den Anwendungsbereich der neuen Vorschriften nach IAS 7.44G fallen. Dabei ist zu prüfen, ob die Kriterien eines Supplier-Finance-Arrangement erfüllt sind, und die entsprechenden Angaben in den Notes aufzunehmen sind. Gemäss IAS 1 ist zusätzlich zu beurteilen, ob diese Angaben qualitativ oder quantitativ wesentlich sind. IAS 7.44H schreibt vor, die Informationen in aggregierter Form darzustellen; eine Aufgliederung wäre nur erforderlich, wenn Vertragsbedingungen wesentlich voneinander abweichen. In Konzernen mit dezentral organisierten Beschaffungs- und Finanzierungsstrukturen kann es dennoch anspruchsvoll sein, alle relevanten Programme vollständig zu erfassen und konsistent zu berichten. Diese Unsicherheit führt auch intern zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf verschiedener Abteilungen wie z.B. CFO Office und Treasury, die gemeinsam mit dem Accounting-Team und der Revisionsgesellschaft klären müssen, wie die neuen Pflichten zu interpretieren sind, Prozesse standardisiert und interne Kontrollsysteme angepasst werden können. Parallel wächst der Druck durch Bilanzadressaten: Besonders Kreditanalysten und Ratingagenturen könnten die offengelegten Informationen als Hinweis auf zusätzliche Finanzierungsrisiken interpretieren, was sich unmittelbar auf Kennzahlen und Ratings auswirken kann. Auch stellen Unternehmen zunehmend bestehende SCF-Programme strategisch auf den Prüfstand, etwa dann, wenn der erwartete operative Nutzen den erhöhten Compliance- und Reputationsaufwand nicht mehr rechtfertigt. Vor diesem Hintergrund rückt die Frage in den Fokus, mit welchen konkreten Massnahmen Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen.
Mögliche Best Practices aus ersten Umsetzungserfahrungen
Nach dem ersten Jahr der praktischen Anwendung der neuen Offenlegungspflichten zeigen sich bereits erste erprobte Massnahmen, mit denen Unternehmen die neuen Anforderungen effizient umsetzen. Ziel dieser Massnahmen ist es, Interpretationsspielräume zu verringern, Prozesssicherheit zu schaffen und die Qualität der Angaben nachhaltig zu verbessern.
Einzelne Unternehmen haben bereits frühzeitig funktionsübergreifende Abstimmungen zwischen verschiedenen Abteilungen etabliert, um ein gemeinsames Verständnis der neuen Offenlegungspflichten zu entwickeln. Parallel dazu werden oft gezielt externe Adressaten, wie z.B. Ratingagenturen, einbezogen, um potenzielle Erwartungen und Auswirkungen auf Finanzkennzahlen zu antizipieren. Auch sehen immer mehr Unternehmen den Implementierungsprozess nicht nur als reine technische Umsetzung, sondern zunehmend auch als Gelegenheit, die eigenen SCF-Programme systematisch zu analysieren und strukturelle Transparenzlücken zu schliessen.
Zur besseren Beurteilung, ob bestimmte Programme nach den neuen Pflichten gesondert offenzulegen oder gegebenenfalls umzuklassifizieren sind, wird in manchen Unternehmen auch die Definition klarer interner Leitlinien vorgeschlagen. Diese sollen unter anderem Kriterien zur Materialitätsbeurteilung sowie Hinweise zur Bilanzierung nach IFRS 9 enthalten. Dabei werden Faktoren wie explizite Zinszahlungen an Factors, das Stellen von Sicherheiten oder auch Zahlungsziele berücksichtigt, die deutlich über branchenüblichen Standards liegen. Solche Leitlinien dienen nicht nur der Konsistenz, sondern helfen auch, den Detaillierungsgrad der Angaben festzulegen, inklusive der Entscheidung, ob über die Mindestanforderungen hinausgehende freiwillige Informationen bereitgestellt werden sollen.
Daneben rückt auch die Sicherstellung konsistenter und nachvollziehbarer Daten stärker in den Fokus. Zentralisierte Templates, standardisierte Datenfelder und klar definierte Verantwortlichkeiten im Reportingprozess unterstützen eine einheitliche Umsetzung der neuen Offenlegungspflichten. In dezentral organisierten Unternehmen wird zudem ein erhöhter Schulungsbedarf gesehen, um die lokale Berichtsfähigkeit zu sichern und eine konsistente Datengrundlage zu gewährleisten.
Ergänzend evaluieren einige Unternehmen, inwiefern freiwillige Zusatzangaben, welche über die Mindestanforderungen hinausgehen, zusätzlich die Transparenz gegenüber Bilanzadressaten erhöhen können. Beispiele hier wären:
- Stichtagsbezogene Buchwerte mit Volumenangaben über das gesamte Geschäftsjahr zu ergänzen, um eine realistischere Einschätzung des tatsächlichen Umfangs der Programme zu ermöglichen.
- Qualitative Erläuterungen zur strategischen Zielsetzung, um den wirtschaftlichen Zweck einzelner Programme zu verdeutlichen.
- Angaben zur Gebührenstruktur und zur Auswahl der Factors, um Transparenz über finanzielle Auswirkungen, Margenbelastung und potenzielle Abhängigkeiten zu schaffen.
- Sensitivitätsanalysen, die aufzeigen, wie sich eine Umklassifizierung auf zentrale Kennzahlen wie Net Debt/EBITDA auswirken würde.
Diese Beispiele ergänzender Angaben können das Vertrauen externer Adressaten stärken, die Informationsasymmetrie weiter reduzieren und eine transparente Governance unterstreichen.
Fazit
Die neuen IFRS-Offenlegungspflichten schaffen benötigte Transparenz über Reverse-Factoring-Programme, fordern Unternehmen aber bei der Umsetzung technisch und organisatorisch auch heraus. Erste Erfahrungen zeigen, dass gezielte Koordination, klare Beurteilungskriterien und freiwillige Zusatzangaben entscheidend sein können, um die regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen und das Vertrauen von Investoren und Bilanzadressaten zu erhöhen.





















































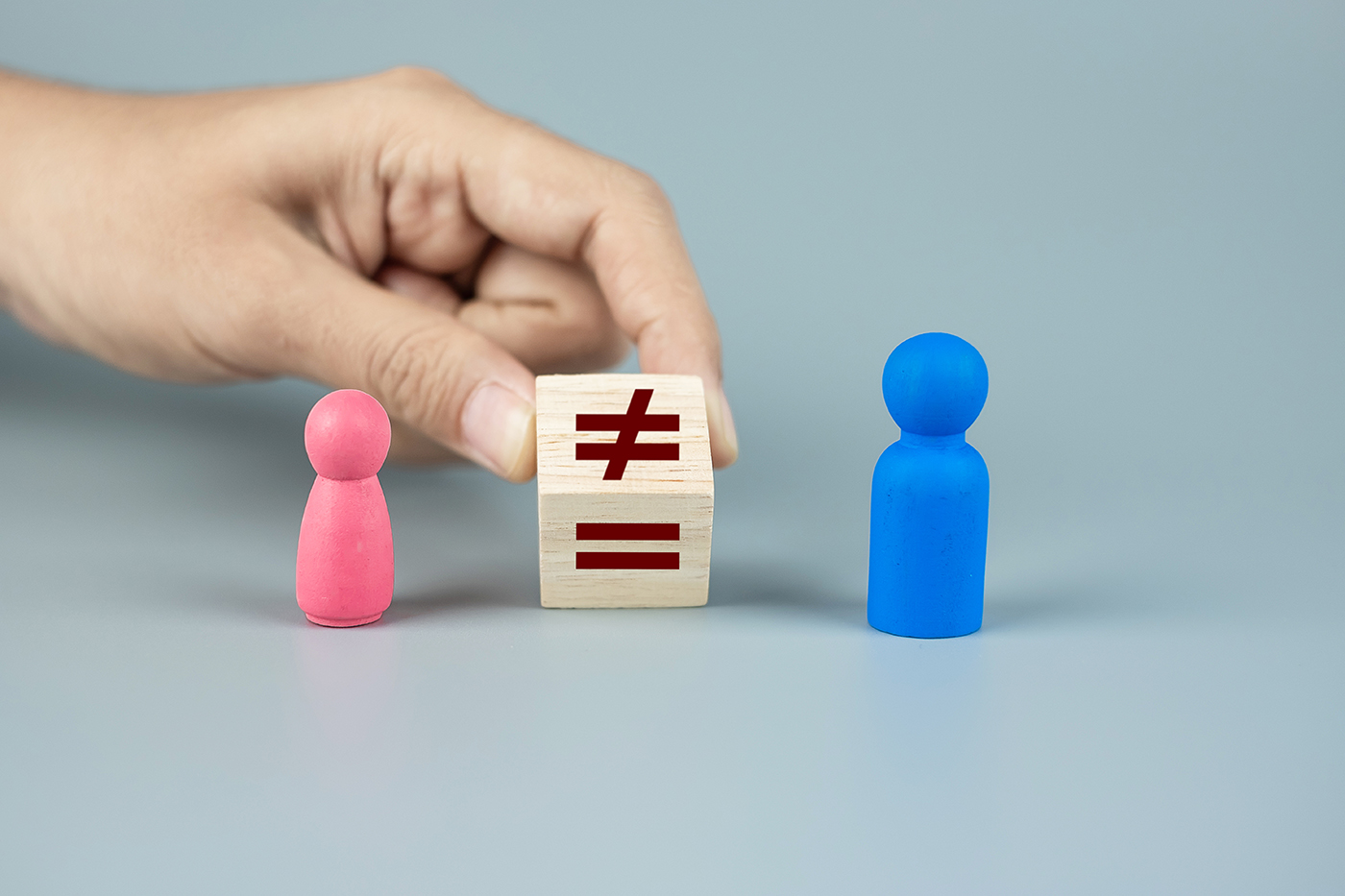

































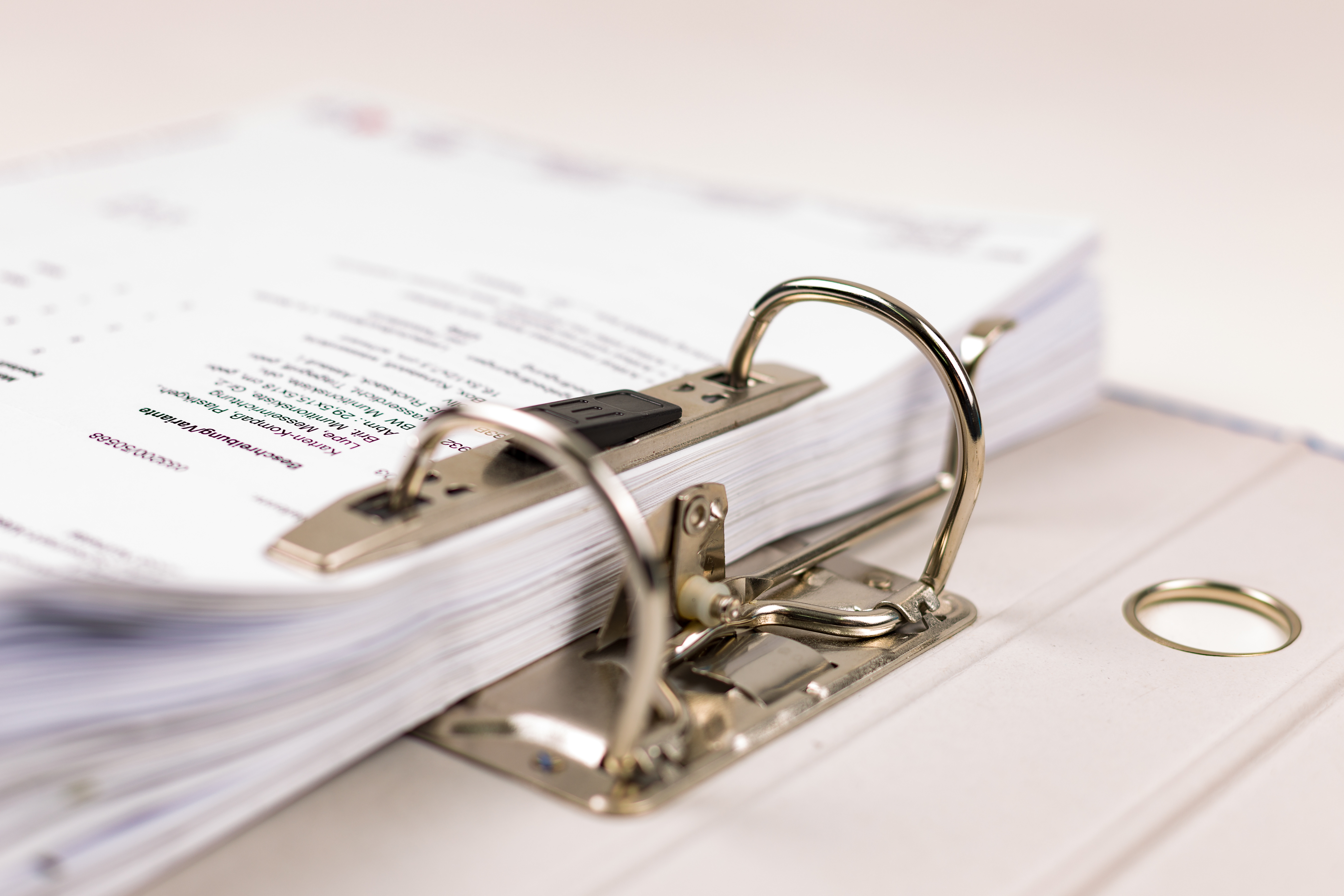



Kommentieren